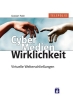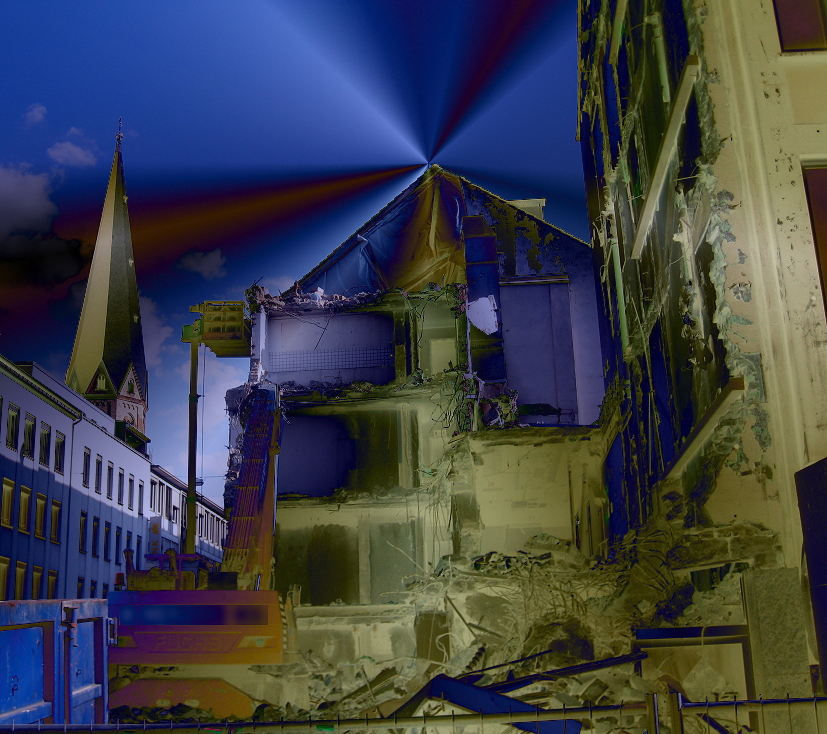|
|
© Goedart Palm
Leere Seiten. Jede Identität sträubt sich gegen die Fixierungen des Gedankenflusses. Schreiben heißt, sich der Wahrheit wegen selbst zu belügen. Oder sollte die Codierung wahr/falsch falsch sein?
Sprachen. Polyglotte Zeitgenossen hoffen immer auf Wahrheiten, die in den anderen Sprachen nicht erscheinen wollen - anstatt die Vater/Mutter-Sprache auf ihre herrlich unvereinbaren Sprachen hin auszuloten. Sprechen wie jeder, sprechen wie Dichter, Philosophen, sprechen wie ein anderer... sprechen wie keiner. Auch in einer Weltsprache blieben die privaten Wahrheiten, die unterhintergehbaren Partikularitäten erhalten.
Dichtung. Aphorismen helfen über den Winter des Schreibens hinweg. Wechselstrom des Textes. Jenseits der Wörter verdichtet sich die Sprachlosigkeit zum Sprachparoxysmus. Verbindliche Sätze? Wer oder was soll aber noch verbunden werden? Wörter als Mullbinden für malträtierte Helden. Die Falten im Gesicht der Literatur sind unübersehbar geworden. Unsere schöne neue Telekommunikation demokratisiert das Geschwätz, aber liquidiert die Dichtung.
Rund. Warum soll es ein Verrat an der Sprache sein, wenn die Wörter so rund sind, dass sie einen schlechten Gedanken adeln?
Veni, Video, Valium. Unerträglich, wenn Schriftsteller Sedative, dämpfende Texturen wie Tinkturen verabreichen, bis sich Übelkeit einstellt. Sprachgewohnheiten und -gewöhnlichkeiten werden ungeprüft exekutiert. Die Bestseller-Unkultur hat das Schreiben im ständigen Glücksversprechen desavouiert. Textwagnisse lassen sich in der Urgeduld vom Papier nicht eingehen. So hat sich Literatur zu einer halbseidenen Angelegenheit entwickelt, bar einer durchgreifenden Legitimität gegenüber einer zugleich globalen wie zersplitternden Welt. Unter dem Trauerflor, der so wohlfeil geworden ist, regt sich ein Lächeln über die selbstgefällige Bescheidung auf das Nichts.
Apokryphe. Textinsel in einem Meer von Lügen.
Riff. Eine Sentenz, die sieben Töne auf dem Griffbrett zu einer Phrase verknüpft, elegant, so als könnte es nicht anders sein...Wie oft hören wir Musik, die Sprache werden müsste und doch nicht transformierbar sein soll. Von daher rührt der Glaube an die Musik als Himmelssprache. Wäre doch nur einer, der sie übersetzen könnte, dass wir sie nicht nur hören, sondern auch verstehen.
Zeitgeist-Poeten. Dichter hasten durch die Geschichte, alles auflesend was rechts und links des Weges liegt, last action poet im Supermarkt der Erzählungen, den Morgen zugebracht mit Mundglockenklang, aber abends in einer billigen Nachtbar versackt. Die verderblichen Mängel umwanden die Geschichte mit ihrem Flickenmantel...
Brockhaus. Die Brockhaus-Enzyklopädie 2000 von André Heller gestaltet und "inszeniert" (Verlagsprospekt). Dass der Mensch einen Brockhaus brauche, mag im Zeitalter elektronischer Medien nicht länger einsehbar sein. Also muss er "inszeniert" werden: Der Zirkuskünstler Heller gestaltet eine Einbandgalerie mit 312 Originalfundstücken, Mercedes-Silberpfeil, Tennischläger von Boris Becker und noch viel mehr -präsentiert in dreidimensionalen Acrylvitrinen, eingebunden in nigerianischem Ziegenleder - für zweitausend Sammler zum Vorauszahlungspreis von 18.800 DM. Die Idee ist so grotesk, dass sie auch den Nichtleser überzeugt. Dieser inszenierte Vitrinen-Brockhaus ist kein armseliges Nachschlagewerk, sondern soll nach dem Willen des Schöpfers ein Kunstwerk sein, zumindest ist er eine Sammlung von Trouvaillen, die auf die Karte des Wissens geklebt werden. Wo früher der Begriff über den Gegenstand regierte, herrscht heute das Objekt. Pure Unmittelbarkeit gegen blindwütige Monitorisierung des Wissens. In die Geschichtsschreibung und Wissensverzeichnung wird die Geschichte als Fetisch eingeführt. Reliquien unserer Zeithöhepunkte, sorgsam verwahrt wie Blut Christi, lignum crucis. Wir wohnen einer religiösen Handlung bei, Brockhaus hebt die Monstranz, zeigt den Leib dieses Jahrhunderts, eine Hostie, die wir essen werden, um zu bezeugen, den Zeitgeist in uns zu haben. Ego te absolvo - "verlieren Sie also keine Zeit" (Verlagsprospekt). Wie sollte ich Zeit verlieren, wenn ich mir die Geschichte selbst einverleibe?
Bibliophil. Der Goldschnitt der alten Gebetsbücher überzeugte uns vom Wort Gottes. Wir strichen über die goldene Glätte, die das Wasser für Wein nahm. Wenig zwar gegen die hochbarocke Gottesherrlichkeit in Oberbayern, aber mehr als die Schnödigkeit unser paperbacks. Gottes Wort war gediegen, also war es auch sein Buch. Aber Bibliophile sind Fetischisten, sie vergessen die Person, müssen sie vergessen, um zum Objekt zu gelangen. Fetischisten machen sich ein Bild, weil ihnen die Wirklichkeit so unheimlich lebendig ist. So ist Bibliophilie eine Leichenbestattungskunst, die weder das Wort noch das Fleisch besitzt. Arme Reiche.
Kriterium. Wer die Qualität einer Geschichte einschätzen will, muß nur die Frage beantworten, ob Figuren aufgedrängt werden. Protagonisten, die nur einen Tintenkreislauf haben, decouvrieren sich schnell.
Helden. Eine Geschichte ohne Helden schreiben oder geschichtslose Helden entwerfen.
Ein anderes Ich. Rimbaud wollte durch die Entregelung aller Sinne beim Unbekannten ankommen. Dagegen: In der Entregelung der Sinne beim Bekannten ankommen. Die Selbstflüchtigen enden im Nirgendwo, weil das Selbst nicht geflohen werden kann. Im Unbekannten ist das Selbst nur noch nicht heimisch geworden. Jedes Selbst hat eine imperialistische Lust, sich überall zu finden. Rimbauds Flucht in unbekannte Länder verlängerte die Poesie des Fremden mit anderen Mitteln. Aber irgendwann kommt man im Fremden an. Alles wird Heimat...
Proust. Wollt ihr nicht sehen, dass diese angespitzten Sensorien einem sadistischen Geist entspringen? Pfählen, Aufspießen, Einschließen. Ein Schmetterlingssammler im Rattenlaboratorium.
Joseph Roth. Der Untergang der Donaumonarchie im Bild des Kaisers, langsam wegdämmernd, sprachlos, hoffnungslos. Jede Zeit hat ihre eigene Sprachlosigkeit. Luzide wirds erst hinterher, wenn analytische Köpfe die fremden Mauern sehen - aber nur so weit, bis sie an ihre eigenen Mauern stoßen. Eine immerwährendes Spiel, die Evolution der Einsicht in die Verhältnisse.
Tangenten I. Aus dem Tagebuch des Schriftstellers Heimito von Doderer. Eigenartig, daß die Vornotiz diese Texte als Quellgrund abwertet, da doch hier wie zumeist die Ursprünge aufregender als die Resultate sind. Überhaupt ist es nichtssagend, ob einer seine Elaborate für groß oder klein hält. Schließlich entziehen sich diese Selbstaussagen jeder Validisierung durch den Autor. Entscheidend ist, wie gut andere anknüpfen können. Tangenten über die Zeiten. Schreib´mir nicht, wer du bist, das kann ich allein entscheiden. Andererseits sind die Prätentionen des Autors Verständnishilfen, die auf die Sache zu beziehen sind.
Tangenten II. Dieses Ungewisse, metaphorisch Schwebende bei gleichzeitiger Arbeit am Begriff... Metaphern helfen oft das zu verstehen, was noch nicht im Begriff verstanden werden kann. Annäherungen an Zustände, die gewiß sind, deren Name aber noch nicht gefunden wurde. Daher fehlt es an Verständlichkeit: Selbstverständigung und Mitteilung. Aber hat sich die Sprache je anders entwickelt?
Elias Canetti. Zürich ist eine wunderbare Stadt für Schriftsteller. Die Splitter Canettis sind wichtiger als Masse und Macht. Canetti ist ein Beispiel für die überschießenden Innentendenzen eines Autors, seinen Stoff nicht nur literarisch, sondern auch wissenschaftlich zu fassen. Aber hängen wir nicht alle an Stoffen, die wir zu immer neuen Kleidern verarbeiten wollen? Das Essay gehört zu den Zwischenformen, die sich nicht festlegen wollen, aber schließlich in der Gesamtausgabe befriedet werden.
Aneignung. Nicht alle Sätze, die wir schreiben, gehören uns schon deshalb. Die geistige Aneignung ist immer mehr als das Wissen. Erst wenn das Wissen unser Bewusstsein imprägniert, eine Struktur schafft, die nicht mehr verlassen werden kann, besitzen wir das Wissen, werden zu diesem Wissen. Die meisten Sätze, die wir sprechen, sind lediglich Markierungen einer Differenz. Wir könnten auch das Gegenteil für richtig halten. Was liegt dabei am Glauben an die Richtigkeit eines Satzes? Sich auf eine Seite zu schlagen, ist zumeist naiv. Im Aufbau der Differenzen erweist sich die Kraft eines Denkens, Glauben ist ein später horror vacui.
Leidmotiv. Jede Zeit hat ihre Leitmotive, denen sie folgt, weil sie sich als neue Phänomene in der Geschichte präsentieren. Uns ist "Masse und Macht" kein solches Motiv mehr, heute werden Massen wie Einzelne immer weniger greifbar. Wir reden inzwischen über Verhältnisse, deren Triebkräfte nicht mehr im Menschen verortet werden wollen.
Knut Hamsun. Mysterien: Der Protagonist Nagel stirbt an seinem Antizipationswahn, ihm fehlt jene Gelassenheit, die nicht an Formeln der Beherrschung glaubt. Auch ihm wird dieser Glaube genommen, aber er macht sich nicht den richtigen Reim auf die Verhältnisse. Warten können ist die Kunst. Diesem Held fehlt aufgrund seiner neurotischen Verfassung das Wissen um die Irrwege, die schließlich zum Ziel führen. Er vermischt die Kraft des Geldes mit romantischen Trugbildern, er setzt sich über Konventionen und gesellschaftliche Schranken hinweg, ohne zu begreifen, dass die Kleingesellschaft noch nicht rückhaltlos dem Machtcode "Geld" gehorcht. Ja selbst er glaubt noch nicht daran, sondern verläßt sich auf "understatement" und will zugleich doch verführen. In dieser Ambivalenz seines Mediengebrauchs folgen ihm die Menschen nicht. Ihr Glaube an die Wertordnung ihrer Gesellschaft wankt zwar, aber die Mittel Nagels reichen nicht aus, diese zusammenbrechen zu lassen.
Ernst Jünger. Ein Sammler und Klassifizierer, der Menschen, Käfer, Situationen etc. verzeichnet. Alt wird einer nur mit der Lust an der Weltwahrnehmung. Wer sich der Welt als Kartograph, Aufschreiber, Korrepititor verdingt, hat Aussichten auf Ewigkeit. Jünger ist ein Geistesverwandter Borges´, der ihn auch in Wilfingen besuchte. Ihr Unterschied liegt dem Reduktionsmus Borges´gegenüber der kulinarischen Abundanz Jüngers, letztlich der Unterschied zwischen Dichtkunst als Verdichtung und Erzählung als Recherche. Die Qualität Jüngers ist sein equilibrium aus Bodenhaftung, Träumen, Drogen, Entomologie, Expressionismus und Sensibilität. Warum Käfer?
Paul Valery. Wer nach Lebenskunst sucht, findet hier. Poesie ist hier kein Zweck, sondern ein Mittel. Allein die Selbstverfassung, das Instrument, die Fähigkeiten zählen.
Mitspieler. Zum Mitspielen gezwungen, ohne den Eindruck zu gewinnen, dass es dem Spielemacher sehr auf mich ankäme. Also kann er auch auf meine Solidarität nicht zählen. Immerhin das ist relative Freiheit. Oder ist es nur eine Täuschung, die zum Spiel gehört, ja mehr, das Spiel erst zu diesem macht.
Bene captatio volentiae. "Möge der Leser mir nicht zürnen, wenn meine Prosa nicht das Glück hat, ihm zu gefallen" (Lautreamont). Selbst in surrealen Höhen und Abgründen denkt man an sein Publikum. Auch hermetische Texte wollen gelesen sein. Für die Schublade produziert niemand. Gibt es nur Verständigungstexte? Aber das riecht nach frustrierten Männerzirkeln und selbstgehäkelten Pullovern. Das coming out ist eine grassierende Obsession: Jede kleine Idiosynkrasie sucht ihren semantischen Hort. Hermetische Dichtung ist auch nur Prätention gegenüber dem allgegenwärtigem Publikum.
Berufung. Über den Dächern jenseits der alltäglichen Verantwortung sollen die anderen nach Brot schreiben, wir schreiben um der Wörter willen. Größte Gefahr: Wörter verlieren. Plädoyer für Sammler. Eine Kollektion sämtlicher Wörter. Wörterbücher als die poetischen Sammelstellen der alten Welt.
Moralsemantik. Angestrengter Humanzynismus gegen Herrschaftszynismus. Karl Kraus führte ziselierte Waffen gegen Grobklotzigkeiten, Gemeinheiten und Sprachverfall. Kein Zweifel, Kraus benötigte zur Selbsterhaltung einen bestimmten Typus von Widersacher, der noch an Kultur/Zivilisation glaubend diese hintertreibt - die offene Antikultur ist nicht mehr durch Präzisionssemantik verwundbar. Heute gibt es keine Feinlehren mehr, die sich erfolgreich gegen öffentliche Planierdiskurse richten. Selbst die Wahl der Unwörter des Jahres begleitet keine Gegensemantik, sondern nur das paradoxe Lächeln über paradoxe Verhältnisse. Vorschlag zur Selbstreflektion: "Unwort" als Unwort einführen.
Maxime. Wer die Sprache gut behandelt, den wird die Sprache gut behandeln.
Grenzen. Jede Sprache hat ihre Grenzen, die sie fortwährend verletzt, um über sich hinaus zu wachsen. Je stärker sie von der Lebenspraxis, unmittelbarer Wahrnehmung abgekoppelt werden kann, desto wahrscheinlicher werden neue Sprachspiele. Aber welchem Motiv folgt die Sprache, die auch dann noch spricht, wenn sie schwerelos zu schweben scheint? Unterhält sich die Sprache dann nur noch mit sich selbst? Was hat sie sich zu erzählen? Sollte die Sprache zuletzt kein Medium, sondern ein Zweck sein?
Plagiat. Sentenzen werden wiedergefunden, kein Bewusstsein besitzt zuverlässige Indices über die Quellen seines Wissens. Wer viel liest, rekapituliert oft unfreiwillig.
Unwörter. Wörter werden zu Unwörtern, weil ihr Gebrauch den Sachverhalt flieht. "Betroffenheit" oder "Befindlichkeit" (Vgl. Graf von Westphalen) sind Eingeständnisse diffuser Beziehungen zu ihren Sachverhalten. Am schlimmsten, wenngleich ehrlich, ist das Erklärungsanhängsel "irgendwie". Irgendwie ist alles irgendwie, aber irgendwie verstehen wir das nicht mehr. In der Denkweise des "Irgendwie" gesteht der Sprecher seine semantische Schwäche. Auch wenn sich längst keiner mehr von dieser Schwäche freizeichnen kann, gibt es zumindest den aufrechten Untergang, der seine Hilflosigkeit laut herausbrüllt. Ein nostalgischer Blick richtet sich auf die altgewordenen Linken, die immer wussten, wo´s langgeht. Diese gottähnliche Sicherheit, jedes Phänomen im großen Entfremdungsinsektarium aufzuspießen.
Bestseller. Druckerschwärze wie Fliegendreck auf ihren Manuskripten. Nur Schreiblust kann keine literarische Legitimation sein: Simmel, Konsalik, Pilcher, Cartland, Steele etc. Zensur tut not. Vox populi funktioniert nicht. Die Bestsellerlisten decouvrieren nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch die moralisch Aufrechten. Frau Dönhoff will auf einem der Spitzenplätze der Verkaufslisten den Kapitalismus zivilisieren. "Jetzt mal ehrlich" - wer hält solche Naivitäten auf Häkelkränzchenniveau noch aus? Häkelkränzchen als feminine Variante des bierhubernden Stammtischs. Wickert als praeceptor Germaniae gehört auch in dieses aufgeblasene Kabinett von moralischen Wichtigtuern, die sich besser ihre zusammgeklaubten Altbestände um die eigenen taubgehaltenen Ohren gehauen und geschwiegen hätten. Appell-Literatur für Pharisäer, die Zeit für wohlmeinende Unverbindlichkeiten haben, während der Rest der Welt weiter verreckt. Mitmachen, aber über "Verhältnisse" klagen. Längst haben die Konservativen die vormals linkskritisierten "Verhältnisse" als moralische Unverbindlichkeitskategorie aufgenommen. Zu Weizsäcker besser kein Wort.
Moral der Literaten. In den 70er Jahren erreichte die Moralisierung der Literatur ihren vorläufigen Höhepunkt. Literatur und Sozialdemokratie verbündeten sich gegen vermeintlich konservative Kulturlosigkeit, weil die Kultur nur von Linksintellektuellen definiert wurde. Böll wurde zum kleinsten gemeinsamen Nenner von Linken und aufklärungswilligen Bürgern. Die "geistig-moralische" Wende schlug zurück, richtete sich gegen linke Wortführer und Betroffenheitsapostel. Die Angewiesenheit beider Positionen auf einander wurde schnell klar, als den Linken der Erzählstoff ausging und die rechten Seifenblasen mal wieder am eigenen Machtdiskurs zerplatzten. Die kulturelle Armseligkeit wurde von der politischen überboten, als sich nicht nur der real existierende Sozialismus verflüchtigte, sondern sich auch linke Programmatik in immer abenteuerlicheren Varianten des beschädigten Lebens erschöpfte. Seitdem kann sich der Kapitalismus, der nicht mehr explizit benannt werden darf, nicht mehr gegen eine feindliche Umwelt definieren. Sollte der Zusammenbruch des Sozialismus auch den Sprengsatz für die endgültige Auflösung des konturlosen Kapitalismus geliefert haben oder ist jener der pantheistisch wabernde Weltgeist? Aber wie jeder Weltgeist zuletzt doch vom Pferd gefallen oder nach St. Helena verbracht wurde, werden auch die neuen Verhältnisse nicht konservierbar sein. Das "Warten auf Godot" hat sich zuletzt immer gelohnt, auch wenn der Erwartete andere Namen tragen sollte. Gleichwohl: Keinem neuen Messianismus das Wort reden.
Rosamunde Pilcher. Also sind Namen doch mehr als Schall und Rauch...
Bouvard und Pecuchet. Zwei Würstchen auf dem kalten Grill der Wissenschaft. Zuletzt wird ihnen alles unkulinarisch. Der Tod in den Wissenschaften, die zu ernst genommen werden. Wenn die beiden Donquichoten etwa Pataphysiker, Feyerabend.... beherbergt hätten, wäre vielleicht Aussicht auf Rettung vor der rationalistischen Unvernunft gewesen. Flaubert, der Idiot der Familie, erzählt eine Geschichte, die seine geworden wäre, wäre er nicht Flaubert geworden. Literarische alter egos sind die Entwürfe, die dem Autor entweder erspart oder nicht geschenkt worden sind.
Fiktiver Roman. Nicht jeder Roman wird aufgeschrieben, aber jedes Leben leuchtet mitunter romanhaft auf. Figurenkonstellationen erscheinen, die mit dem beobachtenden Protagonisten geheimnisvoll verknüpft sind, Erinnerungen legen sich über Wahrnehmungen und machen Ungleichzeitiges gleichzeitig. Je älter einer wird, um so romanhafter wird seine Existenz. Oft würden Skizzen genügen. Die Ausführungen verkleinern oft die diffusen Retrospektiven, die jedes Hirn durchziehen - es sei denn, man hieße etwa Flaubert.
Die Goncourts. Immer da schlecht, wo es um Meinungen geht, allein als Vergrößerungsgläser zu gebrauchen.
Roman. Noch im 18. Jahrhundert war der Beruf des Romanschriftstellers unbekannt. Geschichten, die das Leben schreibt, waren mitteilungs-würdig. Aber fiktive Geschichten waren tendenziell unanständig, überflüssig, jugendgefährdend. Erst als der Roman seine sittlichen Qualitäten unter Beweis stellt - etwa "Pamela" - , wird er salonfähig. Diese Eigenschaften hat er später eingetauscht gegen das pralle Leben, die Irrungen und Wirrungen der modernen Existenz, bis er schließlich an den Rändern zerfaserte, seine Zentren verlor. Seitdem herrscht Arbeitsteilung: Die ins hardcover geschlagene Heftchenkultur reproduziert die geschlossene Form, die Fortführung des modernen Romans besorgen die Neuen Medien. Das Fernsehen erzählt und erzählt und erzählt, ohne noch Zentren zu besorgen.
Buchkultur. In der heutigen Buchunkultur sind keine Widerstände mehr zu erwarten. Demnächst gibt es anstelle von Bücherverbrennungen Vor- und Nachleser, die ungenießbare Seiten für uns wenden. Nietzsches Befürchtung, daß nach einem Jahrhundert Leser die Bücher stinken, ist schon überboten. Heute stinken selbst die Kritiker. "Was ist ein Kritiker? Ein Leser, der Unannehmlichkeiten bereitet", Jules Renard, "Ideen in Tinte getaucht", heute: ein Leser, der Unannehmlichkeiten verhindert.
Fluchtpunkte der Literatur. "Werden die ungelesenen Bücher sich rächen? Werden sie, vernachlässigt, sich weigern, ihm das letzte Geleit zu geben? Werden sie sich auf die satten, die vielfach gelesenen Bücher stürzen und sie zerfetzen?" (Elias Canetti, Die Provinz des Menschen). Aber was ist erst mit den ungeschriebenen Büchern? Werden sie am jüngsten Tag Anklage gegen ihre Väter und Mütter erheben?
Prodromus. Bücherverbrennungen sind unseligerweise aus der Mode gekommen, seitdem unseren gleichermaßen schreib- wie leseschwachen Gesellschaften die Vorstellung irreal wurde, der Geist der Literatur könnte aufwiegeln, rebellisch machen, Staat und Gesellschaft zersetzen. Inzwischen funktioniert die innere Schere so gut, dass sich die Zensoren zur Ruhe gesetzt haben. Aber nicht nur Selbstzensur, sondern auch der allgegenwärtige Glaube, dass Papier geduldig ist, hat staatliche Gelüste, Literatur zu beschneiden, erledigt. Aufruhr und Agitation sind keine Angelegenheit der Literatur mehr. Nicht die von der Pariser APO 1968 beschworene Phantasie, sondern der Euro kommt an die Macht und Intellektuelle haben das Biotop fröhlicher Ideologiekritik verlassen. Im auslaufenden Leitfossil der Epoche, dem Fernsehen, schmücken sich Talk-shows schon lange nicht mehr mit Literaten, Intellektuellen und anderen Bescheidwissern. Niemand mag glauben, dass die Ikone der Fernsehpeepunterhaltung Verena Feldbusch oder ihre redelüsternen Gäste Bücher lesen.
Zensur. Bücher ohne den existenziellen Widerstand der Zensur sind Epiphänomene des bleichbunten Medienbetriebs geworden, der trotz rezessiver Tendenzen der Verlagsbranchen und der dümpelnden Genieproduktion den Markt der Leser wie Nichtleser mit Literaturen überflutet, die keine Notwendigkeit, aber jedes Geschmacksmuster besitzen. Literatur veränderte sich zum Literaturdesign, das den Erwartungsprofilen von Usern, nicht von Lesern folgt. Auf der Jagd nach dem Publikum, den Verlegern und anderen Ulanen des Kulturbetriebs entfesselt sich eine (Text)Materialschlacht der Literaten, die groß- oder kleinsprecherisch ihren Ruhm in den Marmorfries "ars longa, vita brevis" einmeißeln, und noch jeder Schriftgewisse seiner selbstverordneten Personenkultminiatur nachläuft, um schließlich doch nur in einem toten Rennen gunstheischend auf den Knien vor der Diva des Publikums "prodesse et delectare" zu winseln. Doch die Klage über den Literaturbetrieb ist nicht nur alt, sondern auch Teil desselben: "Das unablässige Reden von Literatur, und zwar in der Form des läppischsten Geschwätzes, als ginge es um das Banalste von der Welt, die ewigen Projekte und Versprechungen, das Heruntermachen anderer, das Selbstlob und das Anpreisen von Machwerken, die zum Erbarmen sind: das alles widert mich an" (Leopardi, 1822). Auch wenn wir mit Lust, mit klammheimlicher Freude den Canossa-Passionen der verzweifelten Literatenseelchen zusehen, ja gerne noch einen Essigschwamm in die offenen Wunden reiben würden, haben wir inzwischen alle Blessuren davongetragen, die sich nicht als Stigmata ausgeben lassen.
Abgenetzte Literatur. Literatur ist im Zeitalter medientechnologisch hochgerüsteter Gesellschaften ein fragiles Kulturressort geworden, das Mühe hat, seinen "ontologischen" Status zu bewahren, während es zwischen Fernsehen, Hörkassetten und dem allgegenwärtigen Internet alte Ansprüche verteidigt, die bereits in relativen Blütezeiten nicht eingelöst wurden. Shakespeare´s gesammelte Werke in der Zip-Datei zum "downloaden" werden Leseanreize so wenig auslösen, so wenig hypertrophe Stichwortbildung in außer Rand und Band geratenen Hypertexten Zusammenhänge schafft. "Wer nicht lesen will, muß speichern", lautet die Devise der Netzjunkies. Die Links, die das Hüpfen in den Texten zur Selbstverständlichkeit werden lassen, machen lineare Lektüren überflüssig. Zusammenhänge, die früher durchpflügt werden mußten, werden für den neuen Hyperleser (= Überleser) zum Fluchtfeld. Der hermeneutische Zirkel verkommt zum globalen Zirkelschluss, dass die eilig zusammengerafften Literaturangebote des Netzes bereits Literarizität begründen. Ohnehin ist das Netz der Text, der keiner ist. Das schon vormals grassierende Halbwissen, das vornehmlich im enzyklopädischen Bereich zwischen der Oberweite von Pamela Anderson und dem letzten Promillegehalt von Herbert Juhnke angesiedelt war, wird im Netz gnadenlos aufgerüstet. In der gegenwärtigen Ungestalt des Netzes, ein zusammenhangloser Zusammenhang zu sein, wird Literatur um ihr Eigenes gebracht. Die fröhliche Fiktion der Literatur, ein geschlossener Kosmos zu sein, hält dem Netz nicht stand. Auch die Rezeptionsbedingungen im Global Village spotten der Lektüre als Königsweg intellektueller Welterschließung. E-zines mit Literatur- anspruch stoßen gegen ein Format, das Texte unsinnlich über Monitore scrollen läßt. Kurztexte ohne Diskursanspruch werden zur Norm. Der Modus des zurückgezogenen Lesers wird im Netz aufgelöst. Nur über den Medienbruch des ausgedruckten Textes kann digitale Netzliteratur genießbar werden. Aber die Kondition des Schnellverzehrs von Information sträubt sich gegen kontemplative Lektüren. Hyperlinks, Icons, Bild-Text-Montagen fördern Surflektüren, die im patchwork von Piktogrammen enden. Wir nähern uns den Bilderschriften einer neoägyptischen Epoche, die Franz Werfel schon in den Anfängen des Jahrhunderts prophezeite. Der neue Leser wechselt die Symbolebenen ohne Beharrungsvermögen auf der Linearität von Buchstaben. Das Netz reizt zum Suchen, nicht zum Lesen. Das bessere Wissen liegt immer auf der nächsten website, hinter der bereits verfügbaren Information. Freilich ist das kein Grund, Neil Postmanns Kritik des literarischen Werteverfalls als Endzustand der Mediengesellschaften zu folgen. Noch sind die Entwicklungen der Netzbürger zu ihrer spezifischen Kommunikationsform, ja mehr, zu ihren eigenen symbolischen Konditionen zu diffus, um den Stab zu brechen.
Bestseller. Dass Literatur das Drehbuch des aufklärungswilligen Zeitgeistes ist, haben früher nicht einmal die Skribenten geglaubt, die den Massen zugeschrieben haben, was Demokratien voraussetzen. Aufklärung ist heute das Geschäft der Nachrichten, News-Channel und des Enthüllungsjournalismus geworden. Nachrichtenticker und Mouseclickmessages durchflechten die Benutzeroberflächen. Wer Aufklärung mit Nachrichten verwechselt, verliert auch den Glauben an gesellschaftsstiftende Funktionen der Literatur. Heute ist das Buch zwischen Entertainment und Wissenschaft das antiquierte Medium schlechthin. Auch wertkonservative Leselüstlinge lümmeln sich gelangweilt durch Literaturen, die durch Verlagsprogramme geschleust dem Zeitgeist folgen, ohne die Widerständigkeit, die Nichtverfügbarkeit, die Apokryphe als Leseanreiz länger begreifen zu wollen. So verbreiten Cover und Klappentexte Bücher, die geschrieben, vielleicht auch konsumiert, vor allem aber laut den Bestsellerlisten verkauft werden.
Verlegt. Literatur, die zu Brot geht, ist ohne Medienzurüstung nicht länger überlebensfähig. Die Sprachrohre, die sich aus den Schießscharten des Feuilletons bis in den abendlichen Fernsehalltag hineinschieben, haben ihre vorläufige Höchstform in Literaturverramschungen gefunden, die kammermusikalisch die Präsentation durch Literaturpäpste feiern und Claqueure im leidensbereiten Publikum suchen. Die selbstgefällige Darstellung der Vermittler könnte als Krise empfunden werden, wenn nicht das Pseudocharisma der Medien ihr Eigenes wäre, dem weder Teleprompter noch Souffleur zur Erleuchtung verhelfen. Allen voran kürt das "Literarische Quartett" Bücher zu Bestsellern, die schon morgen Ladenhüter sind. Auf eine Präsentation hin folgen Buchhändler brav mit massiver Werbung für Publikationen, die huldvoll aus dem Meer der Texte gefischt wurden. Vom Winde verweht wurde die Idee des singulären, selbstgenügsamen Textes, der sich in der besonderen Beziehung des Autors zum Leser verwirklicht, Geist zu Geist werden lässt und den individuellen Krisen des suchenden Lesers - von wegen den lesenden Arbeitern von Brecht bis Bitterfeld - auf die Sprünge hilft. Literatur muss sich dem Sensationsparadigma fügen, ohne hier die nötigen Referenzen zu besitzen. Wieso Todes- oder Geburtsjahre Motive für Lektüren begründen, wird für immer das offene Geheimnis der Vermarkter bleiben. Das Buch steht und fällt im Zeitalter seiner ökonomischen Verwertung mit dem Absatz, der zugleich sein Bocksfuß ist. Es spreizt sich in unendlichen Geschichten, die im merchandizing zur Höchstform der medialen Anspruchsstruktur geraten sollen. Das Buch zum Film, nicht etwa der Film zum Buch, markiert die einseitigen Umarmungsverhältnisse der Medienwirklichkeit. Verfilmungen vermehren Editionen und Auflagenzahlen, ohne noch länger von der literarischen Qualität der Texte abhängig zu sein.
Übersetzungen. Die Ensembles aus Text, Film, Kassetten etc. folgen einer Konstruktion, die sich nicht nur extern aus Marktinteressen speist, sondern auch die zentralen Differenzen, die provokative Nichtübersetzbarkeit von Medien unberücksichtigt lässt. Auch wenn literarischen Abfallprodukte kongenial verfilmbar sein mögen, ist "Verfilmung" bereits ein Terminus aus dem Lügenwörterbuch der Medienmafia. Oberflächenmomente wie Namen und Handlungsstränge werden übernommen, der Rest ist kontingent, leugnet Differenzen, um derentwillen das Buch seine Daseinsberechtigung reklamieren könnte und lässt Gemeinsamkeiten außer Acht, um derentwillen der Film eine Aura haben könnte, die im Abschliff des Produktionswahns nicht mehr gelingen will.
Literarische Endspiele. Mit der dichterischen Konzentration auf das Wort, der Ausbildung freier Imagination, dem Abhub der Geschichten der Welt von den Erzählungen der Dichter, der Sensibilität für das Absente, in dem die Wirklichkeit im Sog der Sprache verschwindet, wächst die Spannung zwischen Form und Welt. Hermetische Literatur gerät aber an einen mächtigen Gegner, der den Namen scheut und sich nicht in das Syntagma geordneter Weltbilder ergibt. So hat Cocteau der prometheischen Hybris der Dichter beschieden: "Der Mensch, der das Spiel der Kunst betreibt, beschäftigt sich so durchaus mit seinen eigenen Angelegenheiten, er läuft dabei allerdings Gefahr, Dinge zu berühren, die ihn nichts angehen" (Das Berufsgeheimnis). In dieser Warnung schwingt noch die alte Angst, vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen. Die Gefahr, die Grundfesten der Welt in Wallung zu bringen, scheint den digitalen Demiurgen inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Im Verlust von Ordnung, Form und Bedeutung strudelt Literatur in einem reißenden Mahlstrom der Zeichen, der mehr Kraft der Veränderung besitzt, als es Dichtung je reklamieren konnte.
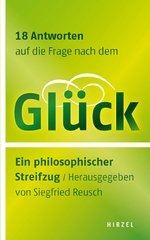
Goedart Palm, Glück und Faulheit, S. 61 ff. in:
18 Antworten auf die Frage nach dem Glück
Ein philosophischer Streifzug - hrsg. von Siegfried Reusch (Autoren: Rüdiger Safranski, Annemarie Pieper, Pascal Bruckner u.a.)
2011. Buch. 232 S. Paperback
S. Hirzel ISBN 978-3-7776-2143-2
| "Alles in unserem Kopfe ist dem Zwang des Augenscheins unterworfen; wir sind nicht für die Wahrheit geschaffen, und die Wahrheit geht uns nichts an. Die optische Täuschung allein soll man erstreben." (Abbé Galiani) |
Zu Urheberrecht und anderen Rechtsfragen: